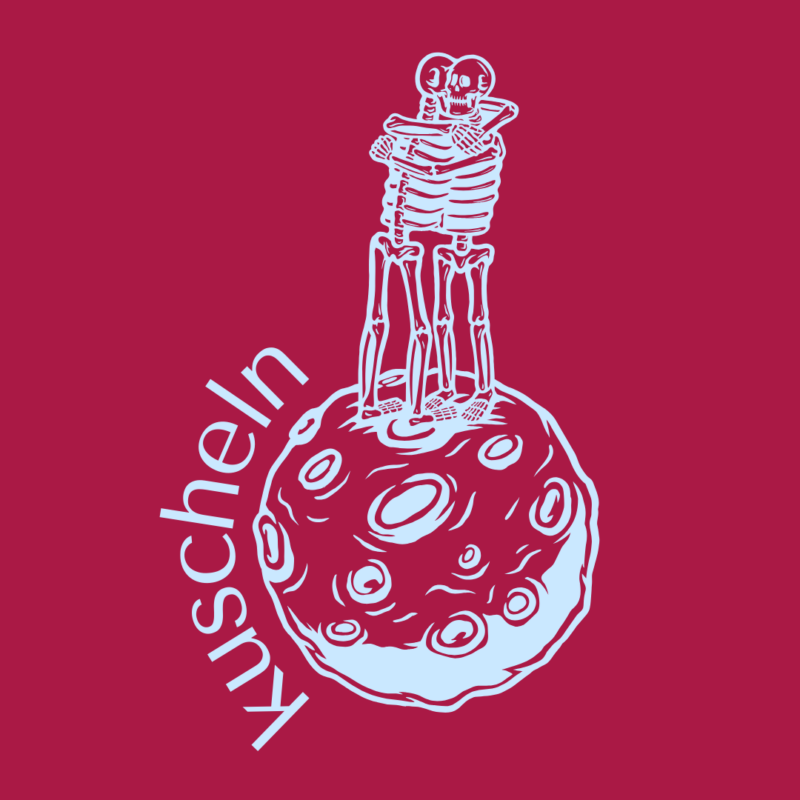Ich bin nicht politisch.
Ich kenne die wenigsten Politiker*innen beim Namen, geschweige denn ihre Position. Ich würde mich immer noch nicht trauen, einem Kind das Wahlsystem in Deutschland zu erklären, solange eine andere erwachsene Person neben mir steht. Ich gehe selten auf Demos. Ich höre weder Radio noch gucke ich Fernsehen, weil beides in meiner jetzigen WG nicht existiert, und meine Hauptnachrichtenquelle namens Instagram habe ich mit Blick auf meine mentale Gesundheit von meinem Handy gelöscht.
Kurzum: Das einzige Weltgeschehen, zu dem ich Kontakt habe, ist das in einem Umkreis von circa hundert Metern um mich herum. Das geht jetzt schon einige Monate so, und was soll ich sagen? Es war eine sehr schöne Zeit. Ich weiß nichts von der Welt und die Welt weiß nichts von mir. Es ist herrlich.
Wenn ich doch mal ungewollt Teil einer politischen Auseinandersetzung werde, halte ich mich verbal zurück und höre stattdessen aufmerksam zu. Schließlich kann man von anderen, Gebildeteren, immer noch etwas lernen. Manchmal versuche ich so sehr, mir ein paar schlau wirkende Zahlen oder Argumente zu merken, dass ich am Ende gar nichts mehr von dem Gespräch mitbekomme. Es hat keinen Zweck. Das ist einfach nicht mein Bereich. Ich schreibe lieber.
Über mein Leben, meine Gefühle. Über scheinbar nichtssagende Dinge. Solche, die mich bewegen.
Darüber, wie es für mich ist, eine Frau zu sein. Sich immer und überall erst beweisen und rechtfertigen zu müssen. Ich dokumentiere meine Einsamkeit in einer überfüllten Stadt, schreibe von vier Millionen Menschen, die sich nicht kennen – wollen. Ich schreibe über Begegnungen. Darüber, was es mit mir macht, wenn ich täglich von mindestens fünf Menschen um Hilfe gebeten werde, die kein Zuhause haben. Ich lasse meinen Frust darüber aufs Papier, dass mein Mitbewohner sich erst umzieht, bevor er rausgeht, weil er Angst hat, man könnte ihm sonst seine Sexualität ansehen und ihm wehtun. Ich mache mich für Körper stark, für jeden einzelnen, in der Hoffnung, dass das Wort Normalität irgendwann wieder den Sinn bekommt, den es haben sollte. Ich schreibe, wenn ich wütend bin. Oder traurig oder frustriert oder verzweifelt oder glücklich. Aber am allermeisten schreibe ich, wenn ich sprachlos bin. Weil mir das Schreiben manchmal leichter fällt als Sprechen.
Und auf einmal wird mir klar: All diese Themen, meine persönlichen Themen, sind größer, als ich denke. Ich bin mit ihnen nicht allein. Im Gegenteil sogar: Das sind Dinge, die uns vermutlich alle beschäftigen. Nur ist es schwierig, das zu erkennen, wenn niemand darüber spricht. Wenn alle genau wie ich davon ausgehen, dass ihre eigenen, alltäglichen Gedanken nicht zählen, nicht ausschlaggebend sind.
Also will ich den Schritt machen und an dieser Stelle mein eigenes Selbstbild hinterfragen.
Bin ich wirklich nicht politisch?
Doch, bin ich. Nur eben nicht so, wie ich es bisher definiert habe.
Es gibt offenbar eine ganze Menge Missverständnisse da draußen und hier drinnen, die dringend mal geklärt werden müssen. Ich fange gerne damit an:
Du musst nicht alle Parteiprogramme durchlesen und bis ins kleinste Detail verstehen, bevor du wählen gehst.
Du musst nicht an allem interessiert sein.
Du musst nicht zu jedem Thema eine fertige Meinung haben.
Du musst auch nicht jeden Tag die Tagesschau gucken.
Du musst nicht mit Zahlen und Fakten um dich werfen können, um an einer Diskussion teilzunehmen. Und schon gar nicht musst du das können, um andere von deiner Meinung zu überzeugen.
Du musst nicht jede Frage bei Wer wird Millionär? beantworten können und du musst tatsächlich auch nicht jedes Sachbuch mit Marker lesen.
All diese Dinge, und das ist eine unfertige Liste, kannst du tun. Tust du es aus irgendeinem Grund allerdings nicht, dann macht dich das nicht weniger politisch als alle anderen. Denn Politik beginnt da, wo wir aufmerksam werden. Wo wir auf einmal wach sind und uns zu Wort melden. Und sei es nur in Gedanken. Politik beginnt bei einem Gefühl.
Es ist kein Wunder, dass junge Menschen bei wichtigen Entscheidungen so wenig vertreten sind, wenn wir unsere Meinung nicht mit der Welt teilen, aus Angst, es fehle uns an Wissen. Wenn alle schweigen würden, bis sie Expert*innen in ihrem Fach sind, wäre diese Welt ein stummer Ort.
Stattdessen ist es hier ohrenbetäubend laut.
Es kann anstrengend und sogar beängstigend sein, wenn alle so durcheinanderreden, aber gleichzeitig liegt darin auch unsere größte Chance. Denn mitten in diesem Lärm finden wir die unterschiedlichsten Stimmen. Und es gibt immer noch Platz für mehr.
Vielleicht sollten wir einfach anfangen.
Mitmischen. Präsent sein. Blickwinkel verschieben.
Schreiben.
Immerzu empathisch, aber nicht ganz so perfektionistisch.
Zahlen können wir auch später noch nachgucken.
Autorin: Tabea Neu studiert Kreatives Schreiben und Texten an der Berlin School of Popular Arts (SOPA).
Foto: Luis Quintero, Pexels